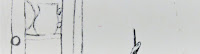Capaillíní
Gegen Ausgang der Spielzeit, Anfang des Monats Februar, sind die Räuber einmal im Freien aufgeführt worden. Das Wintermärchen, das so zustande kam, war nicht allein wegen des Schnees bemerkenswert, sondern hauptsächlich dadurch, daß der Räuber Moor jetzt zu Pferd erschien, was natürlich im Engelwirtsaal nicht gut möglich gewesen war. Er glaube, bei dieser Gelegenheit sei es ihm zum erstenmal aufgefallen, daß Pferde oft einen etwas irren Ausdruck an sich haben. Die gleiche Erfahrung findet er dann widergespiegelt in der Kunst. Auf dem großen Gemälde von der Schlacht auf dem Lechfeld in der Pfarrkirche, wo der Fürstbischof Ulrich mit seinem Schimmel über einen am Boden liegenden Hunnen hinwegreitet, haben alle Pferde diese irren Augen gehabt. Wildpferde haben keine irren Augen, sie blicken ruhig auf die Welt. Die irren Augen der Pferde sind ein Produkt des Zusammenlebens mit den Menschen, ein Phänomen des Anthropozän, und ein Wunder ist es nicht. Man denke nur an die Schlacht bei Marengo, in der neben zahlreichen Soldaten nicht weniger als viertausend Pferde um ihr Leben gekommen sind. Die Vorstellungskraft reicht nicht aus, dies grauenhafte Getümmel der sterbenden Leiber sich zu vergegenwärtigen, die am Schlachtenort errichtete Gedenksäule ist, da muß man Stendhal beipflichten, angesichts der Gewalt des zu Erinnernden nur als mesquin zu bezeichnen. All die ungezählten Schlachten unter Einbeziehung der Pferde, da waren, was den Augenausdruck anbelangt, Veränderungen des caballinen Genotyps unausweichlich.
Naturgemäß gibt es auch nichtkatastrophale Formen des Zusammenlebens von Pferd und Mensch, aber auch die können zwiespältig ausfallen. Berichtet* wird von einem denkwürdigen Pferderennen. Die Wettkampfbezeichnung ist unscharf, da das Starterfeld, abgesehen von den beiden Jockeys, aus einem Pferd im Zustand extremer Altersschwäche und einem Esel besteht. Das Pferd scheut gleich beim Startschuß, so daß dem Esel der Vorsprung gleichsam in den Schoß fällt. Er baut den Vorsprung einerseits beharrlich aus, verspielt ihn andererseits aber immer wieder, da er an den grasbewachsenen Rändern der auf acht Furlong bemessenen Rennstrecke wiederholt Imbißpausen einlegt. Das Ziel bereits vor Augen gönnt er sich dann noch eine längere Pause zur kompletten Darmentleerung. Jetzt sind es nur noch wenige Schritte, da macht der Esel kehrt und tritt eigenverantwortlich und selbstbestimmt den Heimweg an. Eine korrigierende Rückwende in Richtung Zielfahne gelingt im Rahmen der geltenden strengen, auf Fairneß und Tierwohl bedachten Regeln des Jockey Clubs nicht, der Esel trabt unbeirrt zum Stall. Das Pferd seinerseits bricht, obwohl während des gesamten Rennens sehr behutsam und fürsorglich geleitet, auf der Ziellinie unter seinem Jockey tot danieder und wird vom mit dem Schiedsrichteramt betrauten Dorfgeistlichen posthum zum Sieger ernannt. Tod wo ist dein Stachel. Ins Auge hat dem Siegerpferd wohl niemand geschaut, Esel waren in historischer Sicht in weit geringerem Maße Schlachtenteilnehmer und haben den irren Blick nicht in ihrer genetischen Ausstattung. Der spezielle Esel hier hatte ohnehin, wie man landläufig sagt, die Ruhe weg.
*McGinley, Ga Bolga
Gegen Ausgang der Spielzeit, Anfang des Monats Februar, sind die Räuber einmal im Freien aufgeführt worden. Das Wintermärchen, das so zustande kam, war nicht allein wegen des Schnees bemerkenswert, sondern hauptsächlich dadurch, daß der Räuber Moor jetzt zu Pferd erschien, was natürlich im Engelwirtsaal nicht gut möglich gewesen war. Er glaube, bei dieser Gelegenheit sei es ihm zum erstenmal aufgefallen, daß Pferde oft einen etwas irren Ausdruck an sich haben. Die gleiche Erfahrung findet er dann widergespiegelt in der Kunst. Auf dem großen Gemälde von der Schlacht auf dem Lechfeld in der Pfarrkirche, wo der Fürstbischof Ulrich mit seinem Schimmel über einen am Boden liegenden Hunnen hinwegreitet, haben alle Pferde diese irren Augen gehabt. Wildpferde haben keine irren Augen, sie blicken ruhig auf die Welt. Die irren Augen der Pferde sind ein Produkt des Zusammenlebens mit den Menschen, ein Phänomen des Anthropozän, und ein Wunder ist es nicht. Man denke nur an die Schlacht bei Marengo, in der neben zahlreichen Soldaten nicht weniger als viertausend Pferde um ihr Leben gekommen sind. Die Vorstellungskraft reicht nicht aus, dies grauenhafte Getümmel der sterbenden Leiber sich zu vergegenwärtigen, die am Schlachtenort errichtete Gedenksäule ist, da muß man Stendhal beipflichten, angesichts der Gewalt des zu Erinnernden nur als mesquin zu bezeichnen. All die ungezählten Schlachten unter Einbeziehung der Pferde, da waren, was den Augenausdruck anbelangt, Veränderungen des caballinen Genotyps unausweichlich.
Naturgemäß gibt es auch nichtkatastrophale Formen des Zusammenlebens von Pferd und Mensch, aber auch die können zwiespältig ausfallen. Berichtet* wird von einem denkwürdigen Pferderennen. Die Wettkampfbezeichnung ist unscharf, da das Starterfeld, abgesehen von den beiden Jockeys, aus einem Pferd im Zustand extremer Altersschwäche und einem Esel besteht. Das Pferd scheut gleich beim Startschuß, so daß dem Esel der Vorsprung gleichsam in den Schoß fällt. Er baut den Vorsprung einerseits beharrlich aus, verspielt ihn andererseits aber immer wieder, da er an den grasbewachsenen Rändern der auf acht Furlong bemessenen Rennstrecke wiederholt Imbißpausen einlegt. Das Ziel bereits vor Augen gönnt er sich dann noch eine längere Pause zur kompletten Darmentleerung. Jetzt sind es nur noch wenige Schritte, da macht der Esel kehrt und tritt eigenverantwortlich und selbstbestimmt den Heimweg an. Eine korrigierende Rückwende in Richtung Zielfahne gelingt im Rahmen der geltenden strengen, auf Fairneß und Tierwohl bedachten Regeln des Jockey Clubs nicht, der Esel trabt unbeirrt zum Stall. Das Pferd seinerseits bricht, obwohl während des gesamten Rennens sehr behutsam und fürsorglich geleitet, auf der Ziellinie unter seinem Jockey tot danieder und wird vom mit dem Schiedsrichteramt betrauten Dorfgeistlichen posthum zum Sieger ernannt. Tod wo ist dein Stachel. Ins Auge hat dem Siegerpferd wohl niemand geschaut, Esel waren in historischer Sicht in weit geringerem Maße Schlachtenteilnehmer und haben den irren Blick nicht in ihrer genetischen Ausstattung. Der spezielle Esel hier hatte ohnehin, wie man landläufig sagt, die Ruhe weg.
*McGinley, Ga Bolga